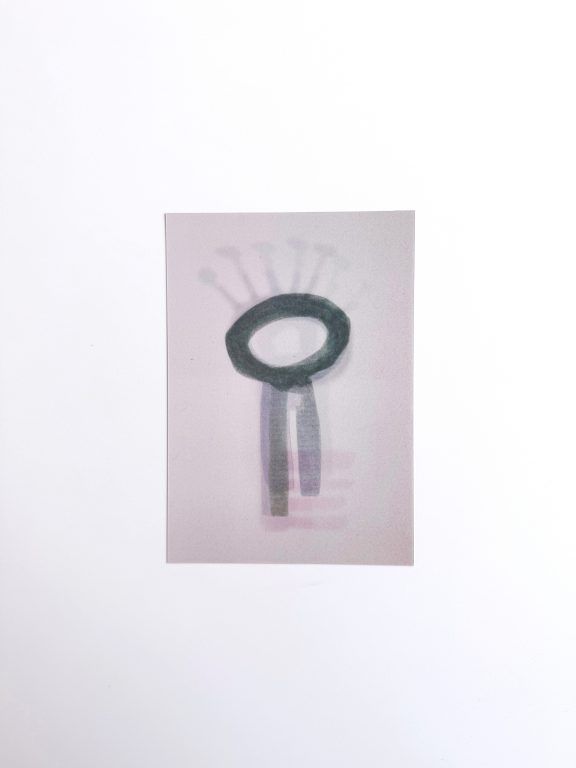Nachhaltigkeit und kreislaufgerechtes Bauen sind zentrale Themen der modernen Architektur.
Doch wie lassen sich ressourcenschonende Konzepte praktisch umsetzen?
Jürgen Naverschnigg ist ein erfahrener Architekt mit tiefgehender Expertise im Bereich nachhaltiges Bauen und schon seit 20 Jahren bei hammeskrause architekten. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Planung von Labor- und Forschungsgebäuden hat er sich intensiv mit ressourcenschonenden Bauweisen auseinandergesetzt.
Seine Antworten im Interview zeigen eine analytische und reflektierte Herangehensweise. Er betrachtet Nachhaltigkeit nicht isoliert, sondern in Verbindung mit der Nutzung, Wirtschaftlichkeit und technischen Umsetzung von Gebäuden. Dabei ist er kein dogmatischer Vertreter einzelner Materialien, sondern wägt Vor- und Nachteile verschiedener Bauweisen ab. Besonders wichtig ist ihm die frühzeitige Integration nachhaltiger Konzepte in die Planung, die Partizipation von Nutzern und Bauherren sowie die Vereinfachung komplexer Prozesse. Seine Perspektive verbindet tiefgehendes Fachwissen mit pragmatischen Lösungsansätzen – eine Kombination, die ihn als Experten auf diesem Gebiet auszeichnet.
Was genau bedeutet „kreislaufgerechtes Bauen“ aus deiner Sicht?
Kreislaufgerechtes Bauen ist ein Teil der Nachhaltigkeitsthematik, geht aber einen entscheidenden Schritt weiter. Jedes Gebäude hat Auswirkungen auf die Umwelt – von der Flächenversiegelung über den Baustoffeinsatz bis hin zum Energieverbrauch. Die zentrale Frage ist: Was passiert mit dem Gebäude, wenn es nicht mehr genutzt wird? Können wir es so planen, dass es auch eine andere Funktion übernehmen kann? Ein Gebäude sollte nicht mit einer festen Halbwertszeit konzipiert werden, sondern langfristig flexibel nutzbar bleiben. Die Wahl der richtigen Materialien ist essenziell, wenn es um nachhaltiges Bauen geht. In unserer täglichen Praxis merken wir, dass hier oft bewährte Lösungen bevorzugt werden. Doch was passiert, wenn wir uns trauen, alternative Wege zu gehen?
Welche Rolle spielt die Wahl der Materialien für eine ressourcenschonende Bauweise?
Sie spielt eine immense Rolle. Die Herausforderung besteht darin, zwischen verschiedenen Materialien und ihren Eigenschaften abzuwägen. Stahl ist beispielsweise ein intelligenter Baustoff, da er zu 100 % recycelt werden kann. Holz bindet CO2, verursacht aber bei der Verarbeitung weniger Emissionen als Beton oder Stahl. Dennoch muss man genau überlegen, wie Holz im Falle eines Rückbaus wiederverwendet werden kann. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile. Der Schlüssel liegt in der zweckmäßigen Anwendung und einer frühen, ganzheitlichen Planung.
Wie können digitale Tools dabei helfen, nachhaltiger zu planen?
Digitale Werkzeuge ermöglichen es, verschiedene Baustoffe bereits in der frühen Planungsphase in Simulationen zu vergleichen. So können wir beispielsweise modellieren, wie sich der CO2-Ausstoß verändert, wenn ein Gebäude in Holz- statt in Stahlbetonbauweise errichtet wird. Hier sehen wir großes Potenzial für die Zukunft. Wir benötigen allerdings effizientere Tools, die diese Vergleiche noch schneller und automatisierter ermöglichen. Neben Materialien ist auch die Nutzung entscheidend. Ein Gebäude kann nur dann wirklich nachhaltig sein, wenn es langfristig genutzt und bei Bedarf angepasst werden kann.
Kannst du ein Beispiel nennen, wo dieser Ansatz erfolgreich umgesetzt wurde?
Ein gutes Beispiel ist die Planung von unseren Laborgebäuden. Hier haben wir bewusst flexible Raumkonzepte entwickelt, bei denen Technikschächte strategisch positioniert wurden, um spätere Anpassungen zu erleichtern. Es wurde von Anfang an mitgedacht, dass sich Anforderungen ändern werden. Dadurch bleibt das Gebäude über Jahrzehnte hinweg nutzbar, ohne dass größere Umbauten nötig sind. Ein häufiges Argument gegen nachhaltiges Bauen sind die vermeintlich höheren Kosten. Doch wenn Nachhaltigkeit frühzeitig in das Konzept integriert wird, entstehen oft ganz neue wirtschaftliche Spielräume.
Wie lässt sich ressourcenschonendes Bauen wirtschaftlich sinnvoll gestalten?
Es beginnt mit der klaren Zieldefinition: Wenn Nachhaltigkeit als elementarer Bestandteil des Gebäudekonzeptes betrachtet wird, können gezielt Kosten eingespart und Mittel sinnvoller eingesetzt werden. Ein Beispiel aus unserer Praxis ist das LSQC-Gebäude: Von Anfang an war klar, dass ein Holzkonstruktionsteil kostenintensiver wird. Durch kluge Planungsentscheidungen, wie den Verzicht auf ein Untergeschoss und die direkte Anordnung der Technikflächen im Erdgeschoss, konnten Mittel gespart und in hochwertigere, nachhaltige Materialien investiert werden. Wir sind überzeugt, dass die Architekturbranche in den kommenden Jahren einen großen Wandel erleben wird. Die Digitalisierung bietet enorme Chancen, Nachhaltigkeit effizienter zu gestalten.
Welchen Stellenwert hat die Digitalisierung hinsichtlich der Planung und Umsetzung?
Nicht mehr wegzudenken; denn digitale Technologien ermöglichen uns, verschiedene Entwurfsvarianten schnell durchzuspielen und ihre Auswirkungen auf Nachhaltigkeit, Kosten und Funktion zu analysieren. Auch der Einsatz von KI wird in Zukunft helfen, intelligente Lösungen schneller zu entwickeln.
Was muss sich in der Branche verändern, um Kreislaufwirtschaft zum Standard zu machen?
Es geht nicht nur um einzelne Baustoffe oder technische Lösungen, sondern um ein grundsätzliches Umdenken. Die Architektur sollte ganzheitlich betrachtet werden – ästhetisch, funktional, ressourcenschonend. Dabei sind oft die einfachsten Lösungen die besten. Wir müssen uns fragen:
Was können wir weglassen? Wie kann Architektur mit weniger mehr erreichen?
Fazit: Architektur mit Verantwortung
Kreislaufgerechtes Bauen ist kein feststehendes Konzept, sondern ein dynamischer Prozess, der sich kontinuierlich weiterentwickelt. Als Architekturbüro sehen wir es als unsere Aufgabe, diesen Wandel aktiv mitzugestalten. Es geht nicht nur darum, nachhaltige Materialien zu verwenden, sondern eine Architektur zu schaffen, die langfristig flexibel, wirtschaftlich und zukunftsfähig ist. Denn die nachhaltigsten Gebäude sind diejenigen, die auch nach Jahrzehnten noch genutzt werden – und nicht abgerissen werden müssen.
Besonderen Dank an Jürgen Naverschnigg für dieses, mit seinen Worten, kurzweilige Interview.